Als Emma weint, lachen andere Kinder sie aus: »Heulsuse, Heulsuse!« Emma weint oft. Sie hat ihre Mutter verloren und ist seitdem sehr verunsichert und den Tränen sehr nahe.
Die Erzieherin möchte Emma schützen und bemüht sich, die anderen Kinder zu stoppen. Das gelingt nur kurzfristig. Also bietet sie eine Gruppenarbeit zum Thema an: »Wenn mir etwas weh tut.« Die Kinder erzählen von aufgeplatzter Haut am Knie, von Bauchschmerzen, vom gebrochenen Arm … »Kennt ihr auch Schmerzen, die man nicht sieht? Dass es innendrin weh tut, im Kopf oder im Herzen, in den Gedanken?« Urs sagt, dass er oft traurig ist, dass sein Papa nicht mehr bei ihnen wohnt. Auch andere erzählen.
Die Erzieherin erzählt vom Schmerzfresserchen, einem Wesen, das den Schmerz aufessen kann. Aber nur, wenn ein Kind den Schmerz zeigt. Zum Beispiel, indem es weint. Mit Tränen kann der Schmerz herausfließen. Wenn Kinder weinen, weiß das Schmerzfresserchen, dass es helfen muss.
Die Kinder malen ihr Schmerzfresserchen.
Dieses Beispiel zeigt, wie verpönt es immer noch ist, Schmerzen und damit Schwäche zu zeigen. Die Erzieherin geht damit beispielhaft um, sie macht es zum Thema der ganzen Gruppe.
Es gibt zahlreiche tolle Angebote, in denen Kinder ermutigt werden, stark zu werden. »Starke Kinder …« und andere mehr. Diese Angebote sind hilfreich. Doch es fehlt etwas. Kinder brauchen auch die Erlaubnis, ihre Schwäche zu zeigen – oder das, was dafür gehalten wird. Ihre Angst, ihre Traurigkeit, ihre Unsicherheit …
Alle Kinder, und traumatisierte Kinder besonders, brauchen eine Ermutigung, ihre Schwächen zu zeigen. Nur dann können sie geteilt werden und geteiltes Leid ist halbes Leid. Nur dann können sie getröstet werden oder andere Unterstützung erfahren. Machen Sie die Erlaubnis, schwach zu sein, zum Thema. Unterstützen Sie Kinder, die ihre Not zeigen. Seien Sie Vorbild, indem Sie auch einmal teilen, dass Ihnen etwas weh tut oder Sie nicht so gut drauf sind.
Ermutigen Sie Kinder, ihre Schwächen zu zeigen.
Buchtipp:
Udo Baer „Traumatisierte Kinder sensibel begleiten“
Basiswissen und Praxisideen
 In jeder Kita-Gruppe gibt es ungefähr ein bis zwei Kinder, die eine traumatische Erfahrung machen mussten, z. B. durch das eigene Erfahren und Miterleben von Gewalt und Missbrauch, Flucht, Tod oder Konfrontationen mit alters unangemessenen Inhalten in digitalen Medien. Diese Zahlen zeigen: Das Thema Trauma ist kein fernes Problem, es kann frühpädagogischen Fachkräften in ihrem Kita-Alltag begegnen.
In jeder Kita-Gruppe gibt es ungefähr ein bis zwei Kinder, die eine traumatische Erfahrung machen mussten, z. B. durch das eigene Erfahren und Miterleben von Gewalt und Missbrauch, Flucht, Tod oder Konfrontationen mit alters unangemessenen Inhalten in digitalen Medien. Diese Zahlen zeigen: Das Thema Trauma ist kein fernes Problem, es kann frühpädagogischen Fachkräften in ihrem Kita-Alltag begegnen.
Das Praxisbuch bietet Basiswissen rund um Traumata bei Kindern, z. B.: Was ist ein Trauma, welche Folgen kann es haben, wie lässt es sich erkennen, was tue ich bei einem Verdacht, wie sollte ich mich verhalten?
Als praktisch ausgerichteter Teil folgt eine breite Palette an Informationen und Angeboten, wie Kinder (trauma-)sensibel begleitet werden können, u. a. Fallbeispiele, Gesprächshinweise sowie zahlreiche Spiele und Übungen, die der Stärkung und der Überwindung von Traumafolgen dienen wie ein Angstfresserchen malen oder Stoppsagen lernen. Alle Aktivitäten fördern auch Kinder, die keinen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren.
Udo Baer
Traumatisierte Kinder sensibel begleiten Basiswissen und Praxisideen
 In jeder Kita-Gruppe gibt es ungefähr ein bis zwei Kinder, die eine traumatische Erfahrung machen mussten, z. B. durch das eigene Erfahren und Miterleben von Gewalt und Missbrauch, Flucht, Tod oder Konfrontationen mit alters unangemessenen Inhalten in digitalen Medien. Diese Zahlen zeigen: Das Thema Trauma ist kein fernes Problem, es kann frühpädagogischen Fachkräften in ihrem Kita-Alltag begegnen.
In jeder Kita-Gruppe gibt es ungefähr ein bis zwei Kinder, die eine traumatische Erfahrung machen mussten, z. B. durch das eigene Erfahren und Miterleben von Gewalt und Missbrauch, Flucht, Tod oder Konfrontationen mit alters unangemessenen Inhalten in digitalen Medien. Diese Zahlen zeigen: Das Thema Trauma ist kein fernes Problem, es kann frühpädagogischen Fachkräften in ihrem Kita-Alltag begegnen.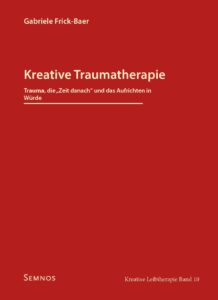 Kreative Leibtherapie Band 10
Kreative Leibtherapie Band 10